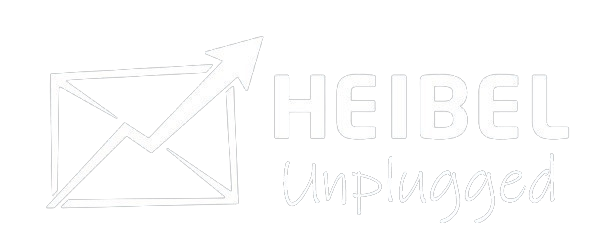animusX Sentiment als aussagekräftige Ergänzung für Prognosemodelle
Interview zum animusX Sentiment im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie
Telefoninterview der Verfasserin am 05.09.2018 mit Stephan Heibel, Herausgeber des Börsenbriefs „Heibel-Ticker“ und Gastautor für diverse Zeitungen, z.B. Handelsblatt, Wallstreet online
Daniel Kahneman selbst beschreibt sich vielmehr als Psychologe denn als Wirtschaftler. Wie viel Psychologe sollte in einem Anlageberater stecken?
„Psychologe als einfühlsamer Berater oder aber für die Interpretation von Marktbewegungen? Wir sprechen hier über verantwortliche Fondsmanager, die sich nach der Erwartungstheorie von Kahneman mit der Verfassung der Marktakteure auseinandersetzen. Nicht umsonst hat Kahneman dafür einen Oscar bekommen, Behavioral Finance wird für Anlageberater immer wichtiger.
Wir beobachten inzwischen, ob Anleger euphorisch oder niedergeschlagen sind. Doch um eine Prognose für die zu erwartende Aktienmarktbewegung daraus abzuleiten ist es wichtig, die Hintergründe einer Stimmungsverfassung und Erwartungshaltung zu kennen. Denn es spielen viele Faktoren in die Stimmungsbildung hinein und da ist schon ein wenig der Psychologe gefragt, um die wesentlichen Faktoren für die aktuelle Stimmung zu erkennen und sodann entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten.“
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist das fehlende bzw. inkonsistente Theoriegerüst im Zusammenhang mit Behavioral Finance. Sie haben sich schon früh dieser verschrieben, während man in Wissenschafts- und Expertenkreisen dem neuen Forschungsansatz noch distanziert begegnete. Was hat Sie dazu bewegt?
„Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde: Einer meiner Kunden hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Sentimentdienst animusX eingestellt werden soll. Ich habe diesen Dienst dann übernommen und der Kunde, ein sehr fähiger Mathematiker, hat den Dienst in den ersten Jahren für mich betrieben. Inzwischen haben wir viele Analysen unternommen und auf Basis der bis 2003 zurückreichenden Daten eine Reihe von Mustern in der Stimmungsentwicklung erkannt, die eine recht hohe Prognosefähigkeit haben. Wichtig ist es, hier zu unterscheiden, dass Sentimentdienste überwiegend die oben beschriebene psychologische Interpretation der Marktereignisse in Zusammenhang mit der aktuellen Stimmungslage bringen und daraus Prognosen ableiten. Wir sind jedoch nun dabei, diese Zusammenhänge mathematisch aufzuarbeiten. Da haben wir schon erste Erfolge, es gibt aber noch viel zu forschen. Gerade der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI) ermöglicht durch die Verarbeitung großer Datenmengen neue Ansätze.“
Welchen Schwierigkeiten stehen Sie bei der mathematischen Aufbereitung gegenüber?
„Das Thema künstliche Intelligenz kennen sie wahrscheinlich. Was wir jetzt hier in dieser rein mathematischen Betrachtung versuchen, ist zum einen Abhängigkeiten in Echtzeit abzubilden. Zudem werden wir externe Effekte in Form von volkswirtschaftlichen Zahlen hinzunehmen. Das ist die Idee dahinter.
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist das fehlende bzw. inkonsistente Theoriegerüst im Zusammenhang mit Behavioral Finance. Welche Vorteile bietet Ihre auf dem Behavioral Finance-Ansatz basierende Strategie gegenüber klassischen Ansätzen?
„Da kann ich Ihnen jetzt sagen, dass ich eigentlich eine andere Erfahrung gemacht habe [die Kritik des fehlenden inhärenten Theoriegerüsts betreffend]. Gerade der kurzfristige Stimmungsindikator, den ich über eine rollierende 5-Wochen-Phase zusammenrechne, hat mir jetzt schon seit vielen Jahren eine sehr gute Prognosefähigkeit gezeigt. Eine Promotion, zwei Masterthesis, und eine Studie sind jeweils zu dem Ergebnis gekommen, dass die Prognosefähigkeit signifikant ist.“
Lagen Sie schon einmal mit Ihrer Investmentstrategie nach dem Behavioral Finance Ansatz vollkommen ‚daneben‘ und was war rückblickend der Grund hierfür?
„Ich gebe meine Wahrscheinlichkeiten an und schließe niemals aus, dass auch aufgrund eines Ereignisses beispielsweise das Gegenteil dessen passieren kann, wofür ich die größte Wahrscheinlichkeit gebe.
Natürlich wurde ich das eine oder andere mal in der Vergangenheit jedoch von internationalen Anlegern überrascht, die den DAX in eine andere Richtung bewegt haben, als ich aus der Stimmung der deutschen Anleger abgeleitet habe. Ich beziehe daher inzwischen stets US-Stimmungswerte in meine DAX-Analyse ein.“
Das Behavioral Finance Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass die Anlageentscheidung nicht nur von dem zur Verfügung stehenden Wissen abhängt, sondern auch von den Emotionen des Anlegers beeinflusst wird. Wo endet also Wissen und wo beginnen emotionale Einflüsse – wo und wie sind diese Sphären zu trennen?
„Fundamentale Entwicklungen an den Märkten und bei Unternehmen schlagen sich langfristig in der Börsenbewertung nieder, kurzfristig jedoch können Bewertungen davon stark abweichen, wenn eine andere Stimmung vorherrscht. Das unangenehme an den Aktienmärkten ist, dass ‚kurzfristig‘ sehr lange anhalten kann. Es gibt keine Möglichkeit zu bestimmen, wann die fundamentalen Entwicklungen in der Bewertung endlich Berücksichtigung finden.“
Liegt das „Geheimnis“ der Börsengenies, wie Warren Buffet, darin begründet, dass sie es schaffen, ihre Emotionen „auszuschalten“? [10:35 – 11:46 min]
„Warren Buffet ist ja auch ein sehr langfristig orientierter Anleger. Wenn man diesen Zeithorizont hat, setzen sich die fundamentalen Bewertungen durch. Von da her hilft es natürlich, diese kurzfristigen emotionalen Schwankungen am Markt zu ignorieren. Das ist sicherlich dann auch eines der Geheimnisse oder auch eines der Erfolgsrezepte von Warren Buffet. Er ist eben nicht auf kurzfristige Erfolge aus, was man immer wieder liest und was er auch immer wieder in den Vordergrund stellt.“
Im computergesteuerten Hochfrequenzhandel (HFT), der die Börsen heutzutage ausmacht, können schon kleinste Fehler oder Abweichungen von der Norm eine Kette an Reaktionen und Gegenreaktionen nach sich ziehen. Verdrängt das hoch technisierte Trading über Algorithmen die Emotion nicht in gewisser Weise aus dem Markt?
„Ich halte HFT für sehr gefährlich: Algorithmen werden für wiederkehrende Handelsmuster entwickelt. Geschieht einmal etwas, das es noch nicht gab, ist die vermeintlich hohe Liquidität, die durch den HFT in den Markt gegeben wird, plötzlich verschwunden. Es passieren Flash-Crashs, wie wir in der Vergangenheit bereits mehrmals erlebt haben.
Im Anschluss werden die Algorithmen neu justiert, für einen kurzen Augenblick haben fundamentale Daten die Oberhand und es findet sich ein neues, häufig vernünftigeres Bewertungsniveau: Manche Aktien können mit höheren Kursen aus dem Flash-Crash heraus, andere mit niedrigeren.
In Marktphasen ohne Flash-Crash werden Emotionen zunehmend berücksichtigt, Sentiment-Daten finden in den Algorithmen immer stärkere Berücksichtigung, wie ich an dem starken Interesse an meinem Dienst animusX ablesen kann.“
Welchen emotionalen Effekten, Heuristiken und Biases würden Sie die größte Bedeutung in der Praxis zusprechen und gibt es Kriterien für diese Hierarchie?
„Extreme Niedergeschlagenheit, die über einen Zeitraum von ca. 4-6 Wochen anhält, hat gemäß einer Masterthesis, die über meine Daten erstellt wurde, die größte Prognosekraft für steigende Kurse. Das kann man auf der anderen Seite nicht über extreme Euphorie sagen, denn die kann länger anhalten, ohne eine nennenswerte Korrektur hervorzurufen.“
Kann ein „Rezept“ für den Umgang mit diesen durch den Anleger abgeleitet werden? Vor allem in Bezug auf folgende Irrationalitäten:
Verfügbarkeitsheuristik
„Ich habe das Gefühl, dass das Gedächtnis immer kürzer wird. Wichtig ist, ob man die Nachrichtengeräusche, die im Alltag auf einen einprasseln, abstrahieren und die ‚echten‘, quasi die fundamental basierten, Entwicklungen herausfiltern kann. Ob man dazu dann Instrumente schaffen kann? Das ist tatsächlich sehr schwer. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn Menschen kennengelernt, die das konnten und Menschen, die das eben nicht konnten.
Es gibt einfach eine grundskeptische Haltung bei den Menschen, die das können: Sie glauben Nachrichten erst einmal nicht und arbeiten tatsächlich sehr zahlenorientiert. Sie berücksichtigen solche Meldungen, die nicht relevant sind, keine große Auswirkung haben oder sich später vielleicht als falsch oder zumindest irreführend herausstellen, nicht. Wenn es dazu Instrumente gäbe, fände ich das toll.
Wenn man jetzt die Sentimenttheorie zu Hilfe zieht und weiß, dass die Menschen zurzeit euphorisch sind und die Nachrichtenwahrnehmung positiv ist, dann sollte einen das zu erhöhter Skepsis bewegen. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder aus der Interpretation der wöchentlichen Umfrage herausziehe.Im Umkehrschluss sollte man natürlich auch, wenn die Menschen gegenüber den aktuellen Marktentwicklungen völlig verunsichert sind und die Nachrichtenlage als verheerend betrachten, den Schluss daraus ziehen, dass die Stimmung schlecht ist und dass egal, was jetzt für eine Meldung kommt – sie wird wieder schlecht interpretiert, obwohl sie vielleicht gar nicht schlecht ist. Letztlich ist das der Versuch das Ganze voneinander zu trennen – wie viel Marktstimmung ist in der aktuellen Interpretation der Meldungen enthalten und wenn es zu viel Pessimismus oder Optimismus ist, dann muss man die Wahrheit an der anderen Ecke suchen.“
Selektive Wahrnehmung
Sie sagen, dass es quasi auch hilfreich sein kann diese Informationen zu selektieren?
Ja: In einer Marktphase starker Niedergeschlagenheit kann man meiner Erfahrung nach negative Meldungen ausblenden und auf das Auftreten einer nicht mehr ganz so negativen Meldung warten. Das reicht dann häufig aus, um eine positive Marktreaktion zu erzeugen.
Ankereffekt
„Ich habe noch einen Börsenbrief – da schreibe ich ganz bewusst nichts über die vergangene Performance. Zwar wird sie irgendwo zu jeder einzelnen Position klein ausgewiesen, aber das wird niemals thematisiert, weil ich eben genau diesen Ankereffekt vermeiden möchte. Es geht um die Zukunft, eben darum, wo die Aktie hingeht und nicht wo sie herkommt. Aus der Sentimenttheorie fällt mir nichts dazu ein.“
Könnte man sich selbst psychologisch überwinden, um diese Vergangenheitsorientierung zu vermeiden?
„Ja, psychologisch ist einfach, dass man sich davon trennen sollte, den Kaufkurs immer mitzuführen und vor Augen zu haben. Der Kaufkurs sollte einem egal sein, genauso wie ggf. steuerliche Belastungen – das sollte man bei der Entscheidung, wann man eine bestehende Position verkauft, eigentlich komplett außen vor lassen. Das ist für mich eine der Regeln, eine der wenigen Regeln, die unter dem Stichwort Disziplin umgesetzt werden muss. Ob man sich psychologisch noch helfen kann? – ich glaube das ist schwer, das ist einfach eine Regel, die man umsetzen muss.“
Disziplin ist ja dann quasi auch schon der psychologische Mantel, in den das Ganze dann gehüllt wird.
„Genau.“
Selbstüberschätzung
„Es gibt zwei Fragen zur Wahrnehmung der Anleger [bei der animusX-Analyse] und daraus leite ich dann einen News-Barometer ab, der zeigt, wie die aktuellen Tagesmeldungen gesehen werden und einen OverconfiX, also einen Indikator, der zeigt, ob die Selbstzufriedenheit überboardet oder ob große Verunsicherung herrscht. Wenn meine Kunden dann sehen, dass zurzeit der OverconfiX, also die Selbstüberschätzung, sehr hoch ist, dann kann man das eben für sich selber dahingehend verwenden, dass man seine eigene Einschätzung relativiert und ein bisschen mehr Skepsis zeigt. Genauso kann man das auch auf der Gegenseite tun.
Mentale Buchführung
„Da wüsste ich von Sentimentseite wenig. Da zieht sich wieder meine Disziplin durch die Antworten, die ich Ihnen gebe. Man sollte sich vorher überlegen: Was für ein Anlageziel hat man mit einer bestimmten Aktie oder einer bestimmten Position im Portfolio? Und das sollte man klar definieren, möglichst aufschreiben, und dann immer wieder überprüfen. Und wenn man dieses Anlageziel irgendwann erreicht hat, dann kann man auch ein neues Anlageziel formulieren, aber man muss immer wieder diese Position vor dem Hintergrund dieses Ziels betrachten. Es hilft, dass man die Argumente dann für eine Position, die man im Portfolio hat, nicht im Laufe der Zeit immer wieder ändert. Wenn es mal eine Spekulation auf eine Zinserhöhung war und die Zinserhöhung ist nicht erfolgt, die Aktie hat sich seitwärts gehalten, und dann sagt man ‚naja, aber vielleicht steigt sie ja trotzdem‘. Das wäre ein Beispiel, wo man einfach in andere Argumente verfällt. Und das sollte man vermeiden, eben durch die Disziplin, sich das Ziel ganz genau zu formulieren und dann auch die Position aufzulösen, wenn das Ziel nicht erreicht wurde oder nicht mehr erreicht werden kann – oder eben erreicht wurde. Das muss man permanent überprüfen.“
Reueaversion
„Da habe ich noch einen anderen psychologischen Kniff, mit dem ich meine Kunden überzeuge, die mich fragen: ‚Soll ich jetzt diese Position, die dick im Verlust notiert, verkaufen – damit würde ich ja meinen Fehler eingestehen – oder soll ich lieber warten, ob sich das noch von selbst ausgleicht?’Da helfe ich meinen Kunden indem ich ihnen sage ‚Schauen Sie sich mal die anderen Aktien an, die Sie vielleicht im Auge haben. Gefällt Ihnen da eine Aktie besser als die, mit der Sie jetzt unzufrieden sind, deren Entwicklung enttäuscht hat. Warum sollte diese es jetzt besser machen als eine andere Aktie, die Sie sich ansonsten kaufen würden.’
Da ist dann vielleicht der Trick, dass man dem Kunden die neue Chance für eine neue Position einfach vor Augen führt, mit der man wahrscheinlich den erlittenen Verlust eher ausgleichen kann als durch ein Aussitzen und hoffen, dass sich die Situation ändert. Grundsätzlich hilft immer der Vergleich zu Alternativen. Das ist besser als wenn man sich nur mit der Entscheidung, ob kaufen oder nicht kaufen, beschäftigt. Man sollte sich dann sagen: ‚Ich möchte jetzt etwas kaufen‘ und sich fragen, ‚welcher Kauf wäre heute attraktiv?“.
Haben sich die verschiedenen irrationalen Verhaltensweisen in der Vergangenheit hinsichtlich ihrer Ausprägung verändert? Inwieweit und wann gleichen sich psychische Irrationalitäten aus, aggregieren oder unterstützen sich gegenseitig?
„Ja, da gibt es eine Reihe von Abhängigkeiten, die ich in meine Interpretation einbeziehe – mathematisch haben wir das jedoch bislang noch nicht ausgearbeitet. So berücksichtige ich insbesondere noch die Positionierung (Investitionsquote, Put/Call-Ratios) der verschiedenen Anlegergruppen sowie auch die Nachrichtenwahrnehmung bis hin zu einem Indikator, der die Selbstgefälligkeit der Anleger anzeigt (OverconfiX).
Bspw:
Positive Nachrichtenwahrnehmung und hohe Selbstgefälligkeit bei steigenden Kursen führen zu Euphorie. Das ist nachvollziehbar und daher keine Warnung für bald fallende Kurse, sondern kann über einen längeren Zeitraum anhalten.
Negative Nachrichtenwahrnehmung und starke Verunsicherung bei steigenden Kursen ist ein Hinweis darauf, dass die Rallye noch eine Weile weitergehen wird.
Negative Nachrichtenwahrnehmung und hohe Selbstgefälligkeit bei fallenden Kursen führen zu nachlassender Niedergeschlagenheit, doch die hohe Selbstgefälligkeit kann steigende Kurse verhindern. Zudem muss natürlich auch die jeweilige Positionierung berücksichtigt werden – Sie merken, es wird sehr schnell komplex.“
„Sie können komplett gegenläufig sein. Sie sind teilweise unabhängig voneinander. Wenn bspw. die Stimmungsindikatoren Niedergeschlagenheit zeigen, dann sagt man sich im Sinne der Interpretation des Sentiments als Kontraindikator: ‚Ich muss jetzt etwas kaufen’. Dann ist nicht die Frage ‚möchte ich diese Aktie kaufen oder nicht‘ relevant, sondern dann ist die Frage zentral ‚welche Aktie möchte ich kaufen, welche gefällt mir denn heute am besten, weil ich ja heute etwas kaufen muss‘. Denn die Niedergeschlagenheit ist so groß, dass es tiefer an den Aktienmärkten eigentlich nicht mehr gehen kann. Und das finde ich ist eine große Hilfe, um dann eine Kaufentscheidung und im umgekehrten Fall eine Verkaufsentscheidung einfach zu erzwingen und über die bereits genannten Punkte [Heuristiken] hinweg zu kommen.“
Sie haben gerade ja schon angesprochen, dass diese sich teilweise verstärken, dass sie unabhängig sind. Sind sie auch unabhängig von der Marktphase oder spielt diese hier eine Rolle?
„Das müsste man im Einzelnen betrachten. Natürlich ist die selektive Wahrnehmung in einer Phase der Euphorie größer, weil man sich durch die Meldungen nur noch bestätigt fühlt. In einer niedergeschlagenen Phase ist man beispielsweise offen für alle Meldungen, auch für welche die nicht der eigenen Überzeugung entsprechen. Also grundsätzlich: Im Einzelnen hängen diese Wahrnehmungen [gemeint sind die Heuristiken, Anm. d. Verf.] natürlich von der Marktphase ab.“
Wie können Kapitalmarktanomalien, an dieser Stelle seien z.B. Über-/Unterreaktionen, Mean-Reversion oder Momentum-Effekte genannt, erklärt werden?
„Ich erkläre das meistens mit technischen Hintergründen.Ein Fonds hat beispielsweise entschieden eine Position in Wirecard aufzubauen, weil sie in den DAX kommt. Er wird die Wirecard-Aktie immer weiter kaufen, bis sie eine beabsichtigte Portfoliogröße erreicht hat, egal, wie sich der Kurs entwickelt. Grundsätzlich ergibt sich daraus eine Übertreibung und das nenne ich dann einen technischen Effekt. Natürlich sind das kurzfristige Effekte, Sentimenteffekte, die zu Übertreibungen führen. Wir wissen auch, dass jeder bei Euphorie kauft, der Taxifahrer ist da das bekannte Beispiel. Wenn selbst der Taxifahrer die Aktie hat, dann gibt es keinen mehr, der den Kurs noch höher treiben kann. Bis dahin werden die Bewegungen der Aktienpreise sowohl nach oben und nach unten wie eine Spirale durch verschiedene Stimmungen immer wieder verstärkt.“
Welche sind die drei wichtigsten Faktoren, die zur erfolgreichen Umsetzung einer Investment-Strategie, die die Erkenntnisse der Behavioral Finance berücksichtigt, beachtet werden müssen?
„Bis heute gibt es meiner Ansicht nach noch keinen rein mathematischen Ansatz, der Erfolg verspricht. Das sieht man auch an den am Markt befindlichen entsprechenden Anlageprodukten: deren Erfolg ist ‚überschaubar‘. Es bleibt also ein wesentlicher Teil psychologische Interpretation dabei und daher sollte man stets auch das Gegenteil nicht ausschließen, also niemals alles auf eine Karte setzen. Wichtig ist auch die klare Definition eines Zeitrahmens, für den man eine entsprechende Prognose erarbeitet hat, denn ‚irgendwann‘ hat jeder Recht, der steigende oder fallende Kurse prognostiziert.
Meiner Erfahrung nach haben depressive Stimmungssituationen die beste Prognosequalität für künftig steigende Kurse. Um dies dann umzusetzen muss man sich gegen die weit verbreitete Meinung des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs stellen und entsprechend Kapital positionieren. Das ist nicht leicht.“
Sie sprechen klare Rahmenbedingungen und konträres Handeln an. Welchen Stellenwert schreiben Sie letzterem zu und wie bewerten Sie Disziplin und Konsistenz im Handeln in diesem Zusammenhang?
„Guter Punkt. Es fällt vielen Anlegern, insbesondere eben den Privatanlegern, die das nicht beruflich und damit emotionaler betreiben, schwer, einem Kontraindikator zu folgen. Sentimentsignale sind ja sogenannte Kontraindikatoren. Wenn die Stimmung schlecht ist, muss man kaufen. Profis, die das als Beruf sehen und die regelbasiert arbeiten, setzen das um. Aber Privatanleger tun sich sehr schwer damit.
Ich gebe meinen Lesern Erklärungen an die Hand und hoffe, dass sie das umsetzen. Das Feedback, das ich dazu bekomme, zeigt mir, dass es ein breites Spektrum gibt: Die Privatanleger, die das beherzigen und sagen „Vielen Dank, so kann ich das jetzt gut weiterverwenden“ und es gibt diejenigen, die das Ganze nicht umsetzen. Generell ist Disziplin in meinen Ausführungen ganz hoch angesiedelt. Wenn man sich bestimmte Regeln geschaffen hat, dann muss man sie umsetzen. ‚Discipline trumps conviction‘ – Disziplin übertrumpft die eigene Überzeugung und danach sollte man handeln. Wenn man sich ein paar wesentliche Regeln aufgestellt hat, dann sollte man sich auf diese konzentrieren und sie umsetzen, auch wenn es gegen die eigene Überzeugung spricht.“
Unterscheiden sich Ihrer Ansicht nach die Kernvoraussetzungen für einen langfristigen Anlageerfolg beim Behavioral Finance Ansatz im Gegensatz zur klassischen Finanztheorie?
„Grundsätzlich: ‚Discipline trumps conviction‘ – das gilt immer, ob man das jetzt für Sentimentsignale anwendet oder Buchhaltungsunregelmäßigkeiten verkaufen muss. Das gilt überall, insofern ändert sich das nicht. Dass man in der Behavioral Finance diese Disziplin vielleicht eher verfolgt, das ist vorstellbar, weil sie aus dem Bereich der technischen Analyse kommt und solche Signale grundsätzlich konsequenter umgesetzt werden, als fundamentale Gründe.“
Welche Methoden verwenden Sie um Verhalten von Marktteilnehmern an der Börse zu prognostizieren und quantifizieren?
„Für meine Marktmeinung ziehe ich das wöchentliche Umfrageergebnis zu Rate. Zudem ist in den vergangenen Jahren ein immer größerer Teil meiner Recherche in geopolitische Vorgänge geflossen. Anlageberatung mache ich nicht, ich schreibe lediglich einen wöchentlichen Börsenbrief, der individuelle Bedürfnisse einzelner Anleger nicht berücksichtigt.“
Ist diese Umfrage die einzige Basis, auf die Sie ihre Analyse stützen?
„Das Umfrageergebnis ist ein Mosaiksteinchen in der Bildung einer Marktmeinung. Es ist ein wichtiges Mosaiksteinchen, aber es sind viele Dinge, die in die Bildung einer Marktmeinung einfließen. Das ist die Politik, das sind Unternehmensmeldungen, Branchenmeldungen, die Konjunktur. Das geschieht heute im Kopf und nicht mathematisch und das ist auch das, was wir anfangs besprochen hatten. In der Zukunft könnte es vielleicht mal ein künstliches Intelligenzmodell geben, was diese verschiedenen Einflussfaktoren zusammenbringt, mit Zahlen bewertet und dann eine belastbare Aussage daraus errechnet. Das gibt es meines Wissens heute noch nicht und es wird wohl auch noch ein paar Jährchen dauern bis das kommt – bis es verlässlich kommt.“
Sind sich die Anleger des Einflusses von Emotionen wirklich bewusst? Diese Heuristiken bestehen ja immer noch, wenn sie sich dessen bewusst wären, könnten sie ja da entgegen handeln.
„Ja, es gibt wenige, die darüber hinweg kommen. Ich hab jetzt natürlich Kontakt zu börsenaffinen Privatanlegern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Diese haben von den ganzen Einflussfaktoren zum Teil schon gehört und überlegen sich, wie sie diese überwinden. Wenn Sie mich jetzt auf die Bevölkerung in Deutschland ansprechen – na klar, die sind sich dieser Effekte nicht bewusst und deshalb gibt es diese nach wie vor. Wie ich vorhin sagte: 90, 95, 98% – also die meisten der Privatanleger, schaffen es nicht darüber hinwegzukommen, auch wenn sich dieser Probleme bewusst sind.“
Ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch die schlechte finanzielle Bildung als Grund aufzuführen? Um diese ist es ja nicht besonders gut bestellt.
„Ja, absolut. Da werden Sie auch keinen aus der Branche finden, der da widerspricht. Das ist ein wichtiges Thema, das in die Schule gehört. Ich habe einige Jahre in verschiedenen anderen Ländern gelebt. Dort werden solche Themen wesentlich offener diskutiert. Das scheint hier in Deutschland ein Tabuthema zu sein, über Geld sprich man nicht.“
Sie sagen auch, dass institutionelle Anleger – ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier vielleicht auch nur so herauslese – im Gegensatz zu den Privatanlegern vorzugsweise nach mathematischen Modellen handeln. Meinen sie jetzt damit, dass sie sich eben dieser Emotionen nicht im gleichen Rahmen bewusst sind, weil eigentlich hätten sie ja den größeren Wissenspool, auf den sie in dem Zusammenhang zurückgreifen könnten?
„Ich glaube, dass die Institutionellen Anleger sich dieser emotionalen Effekte bewusst sind, und deswegen stärker auf mathematische Modelle vertrauen. Den Unterschied, den ich persönlich sehe, ist, dass institutionelle Anleger regelbasiert handeln. Diese Regeln werden in der Institution geschaffen und nicht vom Individuum. Das heißt diese Regeln müssen dann sehr generalistisch formuliert sein, sodass einiges nicht abgedeckt wird. In meinen Augen gibt es zu viele Regeln für die institutionellen Anleger und dadurch wird ihnen ein großer Teil an Flexibilität genommen.“
Risikomanagement nimmt einen hohen Stellenwert in Ihrem Investmentansatz ein. Wie wird dies von Ihnen konkret umgesetzt? Welche Korrelationsrisiken werden dabei berücksichtigt?
„Ich führe ein Beispiel-Portfolio, in dem ich nach Branchen, Regionen und Risiko differenziere.
a) Branchen: Es werden Branchen definiert, die aktuell „investierbar“ sind, und welche nicht. Die „investierbaren“ Branchen versuche ich dann mit Einzeltiteln abzudecken.
- b) Regionen: Als Deutscher Anleger empfehle ich 40-60% der Aktien aus Deutschland, aktuell 20-30% aus den USA, 10-20% aus Südostasien / Japan sowie einen kleinen Teil aus Schwellenländern.
- c) Risiko: Aktuell empfehle ich 20% des Portfolios in Gold und Unternehmensanleihen zu investieren (Absicherung), 25% in Dividendentiteln (Stabil) und weitere 30% in Wachstumstitel. Mit 15% des Portfolios kann man auf aktuelle Entwicklungen reagieren und 10% sind für Spekulationen vorgesehen.
Neben der ‚intellektuellen‘ Berücksichtigung dieser Vorgaben führe ich regelmäßig eine Korrelationsanalyse nach Markowitz durch, um gegebenenfalls Beziehungen mit hoher Korrelation aufzufinden, die sich ‚intellektuell‘ nicht so leicht nachvollziehen lassen. So zeigt sich in der jüngeren Zeit zunehmen, dass alle DAX-Aktien, ungeachtet ihrer Branchenzugehörigkeit, streckenweise parallel laufen, weil der DAX von internationalen Anlegern einfach nur als Exportindikator betrachtet und gehandelt wird.“
Diversifikation ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Baustein des Risikomanagements, aber gerade in unruhigen Zeiten am Kapitalmarkt gelingt es Anlegern nicht ihr Portfolio durch ausreichende Diversifikation zu stabilisieren. Können Ihrer Ansicht nach in diesem Zusammenhang Werkzeuge wie antizyklisches Handeln und Stop-Loss Limits am Ende es Tages auch effektiv sein, um dieses Risiko aufzufangen, das eben durch die Diversifikation nicht ausreichend eliminiert werden konnte?
„Antizyklisches Verhalten kann man ja sehr gut im Zusammenhang mit der Sentimenttheorie anwenden: Sie kann helfen Werte zu identifizieren, die unterbewertet sind, die konjunkturell eine schwere Zeit hinter sich hatten und auch deshalb unbeliebt sind. Das ist eine sinnvolle Risikostrategie in meinen Augen.
Den Stop-Loss, den Sie noch angesprochen haben, den verwende ich sehr selten. Das hat bei mir aber auch eine praktische Bedeutung: Wenn ich in meinem Börsenbrief bestimmte Stop-Loss-Marken veröffentliche, dann hat das zur Folge, dass auch Börsenbetreiber und andere Trading-Desks diese Stop-Loss-Marken lesen und dann wissen die ‚Aha, die Kunden vom Heibel-Ticker haben jetzt bei ihrer Bank eine Stop-Loss-Order bei dem und dem Kurs hinterlegt und dann kann man so was wunderbar ‚abfischen‘. Also sie können dann den Kurs mit ein paar schnell aufeinanderfolgenden Trades auf das Stop-Loss-Niveau bringen, wissen, jetzt kommen eine Menge Verkaufsaufträge, die dann zu einem günstigen Kurs einkaufen und am Ende des Tages steht der Kurs wieder deutlich höher. Deswegen arbeite ich nicht mit Stop-Loss-Marken, um eben das zu verhindern.
Ich hab natürlich Stop-Loss-Marken im Kopf oder auch notiert, aber keine automatischen Orders darauf gesetzt und betrachte dann beim Erreichen von bestimmten Marken die Aktie wieder. Dadurch habe ich bei der Entscheidung häufig einen Tag Verzögerung, aber das hat sich in der Regel bewährt, weil man solche technischen, kurzfristigen Schwankungen herausfiltern kann.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich je nach Marktphase reagiere. Also für mich stellt neben der Diversifizierung auch der Cash-Anteil im Portfolio die beste Risikostrategie dar. Dieser wird hochgefahren, wenn sich in der Stimmung Euphorie zeigt und die Cash-Position wird dann heruntergefahren, wenn die Stimmung niedergeschlagen ist. Daraus leite ich dann die Entscheidung ab, dass ich jetzt etwas kaufen muss. So sollte man handeln, auch wenn das gegen die eigene Überzeugung oder Wahrnehmung spricht. Das ist die Disziplin, mit der man dann auf solche Entwicklungen reagieren sollte. Mit dieser Risikostrategie fahre ich eigentlich seit einigen Jahren ganz gut.“
Nochmal kurz auf das Stop-Loss eingegangen – Wenn Sie jetzt Privatanleger wären, würde Sie dann auch nur im Kopf diese Stop-Loss Orders platzieren oder dann tatsächlich?
„Das steht natürlich jedem frei und ist auch ein bisschen von der Position abhängig. Wenn man eine hochspekulative Position hat und nicht permanent das Auge am Markt haben kann, dann darf sich in meinen Augen natürlich jeder Privatanleger eine Stop-Loss-Order reinlegen. Aber wie gesagt, ich bin da mit dieser automatischen Stop-Loss-Order vorsichtig. Grundsätzlich gebe ich es meinen Kunden an die Hand, Stop-Loss Orders zu vermeiden, insbesondere eben je längerfristiger Positionen gedacht sind. Je kürzer und spekulativer eine Position ist, desto sinnvoller kann es sein eine Order zu setzen, damit man nicht plötzlich einen Verlust von 30 oder 50% verbuchen muss.“
Wie stehen Sie hier Ihren Anlegern zur Seite, eine Selbsteinschätzung vornehmen zu können, um darauf eine geeignete Investmentstrategie im Hinblick auf den Behavioral Finance-Ansatz abzuleiten? Welche Komponenten spielen hier Ihrer Erfahrung nach die größte Rolle und müssen genauer beleuchtet werden?
„Aufklärung. Als Herausgeber des Börsenbriefs Heibel-Ticker lege ich Wert auf Erklärungen, damit der Leser in die Lage versetzt wird, eigene Anlageentscheidungen zu treffen. ‚Tipps‘ führen Kunden meiner Erfahrung nachfrüher oder später zwangsläufig in große Verluste. Erklärungen hingegen führen zu mündigen Kunden. Ich gehe regelmäßig auf Zusammenhänge zwischen dem Umfrageergebnis der Sentimentanalyse und deren Bedeutung ein. Zudem verfasse ich jeden Montag für das Handelsblatt eine Auswertung, die von dortigen Journalisten in eine leicht verständliche Fassung verarbeitet wird. Es ist einer der wenigen Bereiche, der auch nach der Einführung der Paywall beim Handelsblatt kostenfrei zur Verfügung steht, dafür habe ich mich eingesetzt: https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/dax-umfrage-anlegerstimmung-spricht-gegen-heftigen-ausverkauf-beim-dax/22986394.html?ticket=ST-1544471-AlIkxsRGuQdtWPzbQmbg-ap4Letztlich zeigt sich immer wieder, dass gerade der Gedankenansatz des ‚Kontraindikators‘ für Anleger zwar nachvollziehbar, aber schwer umsetzbar ist.“
Investmentstrategie:
Ihre Maxime ist „gegen den Strom schwimmen“ und konträr zu handeln – wie identifizieren Sie einen Handlungsbedarf oder Krisenerscheinungen frühzeitig und wie werden diese dann von Ihren Anlegern umgesetzt?
„Insbesondere in Krisenzeiten, wenn die Aktienmärkte scheinbar unaufhaltsam fallen, erstelle ich eine Checkliste der wesentlichen Bedenken, die im Markt bestehen. Für jedes vermeintliche Problem – es ist unwichtig, ob es ein Problem ist oder ob es nur als Problem wahrgenommen wird – denke ich mir eine vermeintliche Lösung aus. Wenn alle Punkte der Checkliste durch entsprechende Meldungen abgearbeitet wurden, beginnen die Kurse in der Regel zu steigen. Das trifft dann üblicherweise mit der größten Niedergeschlagenheit zusammen, denn nicht umsonst habe ich die Begriffe ‚vermeintlich‘ verwendet: Weder Probleme, noch Lösungen sind in der Regel groß genug, um die Welt aus den Angeln zu heben.“
Ein Blick in die Zukunft:
Genauso wie der Aktienhandel durch hochtechnisierte Computersteuerung und -automatisierung verändert wurde, so befindet sich auch die Anlageberatungslandschaft im Wandel. In den Niederlanden und in Großbritannien ist man längst auf ein honorarbasiertes System übergegangen, das Angebot der Online-Plattformen, die Information und Beratung bei standardisierten Finanzprodukten bieten, wird zusehends größer. Können solche Plattformen den klassischen Anlageberater ersetzen?
„Solche Systeme / Plattformen können meiner Einschätzung nach langfristig nicht verträglich laufen. Die Benchmark ist die globale Wirtschaftsentwicklung und die Anlageberatung konzentriert sich darauf, dass der Anleger mit seinem Kapital an der globalen Entwicklung partizipiert. Damit können Anleger, wenn sie vernünftige Angebote wählen, große Verluste vermeiden und das reicht den meisten Anlegern bereits aus. Wer langfristig ‚besser als der Markt‘ sein möchte, der muss sich selber mit den Anlageentscheidungen auseinandersetzen.“
Sie spielen hier auf die Aufklärung und auch Mündigkeit an. Wie würden Sie sagen kann dieses ‚besser als der Markt‘ dann konkret erreicht werden?
„Seit über 10 Jahren führe ich ein Beispielportfolio – ich nenne es nicht Musterportfolio, weil es nicht 1:1 nachgebildet werden soll. Aber es ist doch sehr konkret. Damit bin ich über die Zeit besser gefahren als der Markt. Was ist der Markt, ist das der DAX oder der Dow Jones? Ich habe jetzt bei beiden ganz gut abgeschnitten, also ich bin besser als beide. Aber grundsätzlich müsste ich mir als Benchmark selbst einen kombinierten Index bilden, wobei ich eben auch Gold und Unternehmensanleihen und eben einen Cash-Bestand halte, der bei solchen Indizes nicht berücksichtigt wird. Von daher ist ein Vergleich immer schwer. Es reicht also auch schon, wenn man sich damit wohl fühlt und mit der Konjunktur mitfährt.“
„Es ist ‚tierisch unsexy‘, dass ein Schwerpunkt bei allen Anlageentscheidungen auf der Fehlervermeidung liegt. Bei meinem Ansatz gehe ich auf solche Diversifizierungsthemen ein und bringe auch die Sentimenttheorie sehr stark mit ein. Ich reagiere auf aufziehende Risiken und fahre die Cashquote hoch und kann so insbesondere auch in schwachen Marktphasen oder auch in Abwärtsmärkten das Portfolio relativ stabil halten. Über die Zeit akkumuliert fahre ich so besser als die Indizes. Nicht weil ich die heißen Renner im Portfolio habe, die den DAX outperformen, sondern da ich die großen Verlustbringer in schweren Marktphasen nicht in meinem Portfolio habe. Und dieser Effekt ist über die Jahre erstaunlich groß – das macht dann Spaß. Leider geht einem immer das Risiko und nicht die Chance durch den Kopf. Deshalb ist das Thema leider unsexy und deswegen machen das sehr wenige.“
Würde die dahinterstehende Technologie vielleicht die Möglichkeiten bieten, von der menschlichen Emotion mehr Abstand zu nehmen?
„Ja. Das ist kurzfristig manchmal richtig. Ich sehe die Gefahren hinter solchen Plattformen aber als größer an. Es ist eine gute Chance sich mit seinen eigenen Emotionen besser auseinanderzusetzen und in meinen Augen ist es ein Delegieren der Verantwortung, wenn man solche Plattformen nutzt. Wir hatten es vorhin – die Bildung in Finanzfragen ist in Deutschland nicht die beste und wenn dann man mit fehlender Bildung das ganze Thema delegiert, dann ist das mit einem Chef vergleichbar, der Menschen in einem Thema führt, von dem er keine Ahnung hat. Das ist schwer, um es mal vorsichtig zu sagen.
Wenn die Profis, die sich damit täglich auseinandersetzen, bestimmte Plattformen aus bestimmten Gründen in ihr Portfolio mischen, dann haben sie sich Gedanken dazu gemacht. Dann ist das bestimmt auch für einen überschaubaren Zeitraum sinnvoll, dafür gibt es solche Produkte. Aber dass der Privatanleger sich mit so einer Entscheidung praktisch die Verantwortung vom Körper hält, halte ich für nicht den richtigen Weg.“
Eine Schweizer Studie stellte fest, dass – vor allem getrieben durch die Finanz- und Wirtschaftskrise – sich die Kundenbedürfnisse sowie deren Verhalten nachhaltig ändern. In wie weit sehen Sie hier eine Chance für die Behavioral Finance sich zu etablieren und expandieren?
„‘Sicherheit und Vertrauen‘ gewinnen der Studie zufolge nachhaltig an Bedeutung. ‚Nachhaltig‘ für 2 Jahre? Dann stimme ich zu. Doch die nächste Hausse an den Aktienmärkten, spätestens die nächste Generation von Anlegern wird sich an die Lehren der Finanzkrise nicht mehr erinnern. In Folge des Börsencrashs 1929 wurde die Uptick Rule 1938 eingeführt, um heftige, sich selbst verstärkende Ausverkäufe zu vermeiden. Diese Uptick Rule wurde 2007 abgeschafft, es folgte die Finanzkrise mit exzessiven Ausverkäufen. Behavioral Finance ist eine Komponente bei der Anlageentscheidung. Sie findet immer mehr Beachtung. Das aktuelle Bedürfnis von Anlegern nach Sicherheit und Vertrauen kann damit gestillt werden, doch allein Behavioral Finance reicht dazu nicht aus.“
Was sehen Sie jetzt hier als weitere Faktoren an, um dieses zu stillen?
„Indem man die Leute selber in die Lage versetzt die Entscheidungen, die sie treffen nachzuvollziehen. Wenn man delegiert, aber dann nicht in der Lage ist, zu verstehen, warum die Plattform oder der Fonds, oder wem auch immer man das Geld gegeben hat, jetzt besser oder schlechter war als der Markt, dann ist das eine problematische Konstellation. Die meisten Menschen in Deutschland sind ja komplette Analphabeten, was das angeht. Sie wissen ja gar nicht, was man wie vergleichen kann. Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Und zu dem, was man nicht kennt, kann man auch kein Vertrauen aufbauen. Von daher ist weiterhin mein Credo, das hier Aufklärung und Bildung gefordert sind – mehr noch als Formulare und irgendwelche Mechanismen. Das ist in meinen Augen sogar die falsche Richtung. Das täuscht eine Sicherheit vor, die nicht gegeben ist.“
Sie sagen, dass die „nächste Generation von Anlegern sich an die Lehren der Finanzkrise nicht mehr erinnern“ wird. Sehen Sie jetzt hier, allgemein auch in dieser Erinnerung, dass hier die Behavioral Finance die Chance hätte, die klassische Finanztheorie, die sich ja sehr lange im Vordergrund gehalten hat, nicht unbedingt zu verdrängen, aber eben aus dem Vordergrund zu ‚nehmen‘?
„Ich finde die Finanztheorie weiterhin gut und ich gehe davon aus, dass Behavioral Finance als eine Komponente eingearbeitet wird. Und je mehr Daten wir zur Behavioral Finance haben – also je länger die Datenreihen zurückreichen – desto mehr Marktphasen wird es geben, in denen man die Stimmungen vergleichen kann. Von daher wird das immer relevanter werden. Meine Datenreihe geht zurück bis 2006. Das heißt die Internetblase oder den Oktobercrash 1987 und solche Ereignisse haben wir natürlich noch nicht erfasst, aber doch die eine oder andere turbulente Marktphase.Diese werden auch weiterhin vorkommen. Je länger die wöchentliche Umfrage fortgeführt wird, desto besser wird die Aussagekraft für die bestehenden Muster, die man erkennt.“
Es ist ja so, dass es bisher – anders als vielfach vorhergesagt, keine neue Finanzkrise gab. Die traditionelle Seite interpretiert dieses Ausbleiben als Bestätigung ihrer Position – dass eben diese psychologischen Faktoren und das ganze Behavioral Finance Konzept nicht diese große Rolle spielt. Wie ich jetzt eben rausgehört hab, sehen Sie das quasi so, dass es jetzt immer mehr im Kommen ist. Können Sie da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen?
„Ich habe einen Datenschatz, der bis 2006 zurückreicht. Davon gibt es nur 3 Stück in Deutschland – über deutsche Anleger. Da gibt es noch Sentix und Joachim Goldberg. Und von daher kann da die Theorie hier in Deutschland noch gar nicht so fortgeschritten sein, dass man hier Ableitungen draus ziehen kann. In den USA ist das Thema schon älter, von daher gibt es da auch mehr Möglichkeiten. Hier in Deutschland habe ich jedenfalls festgestellt, dass die Prognosequalität für die extreme Niedergeschlagenheit sehr groß ist.
Extreme Euphorie auf der anderen Seite kann sich sehr lange halten, insbesondere in Kombination mit anderen Faktoren, wie die Nachrichtenwahrnehmung. Wenn ich sehe, es gibt fortwährend gute Meldungen und das wird auch von den Marktteilnehmern positiv wahrgenommen, trotzdem ist die Selbstüberschätzung noch nicht zu hoch, dann kann eine Euphorie über die steigenden Kurse im Markt sehr lange anhalten. Dann hat man vielleicht mal einen konjunkturellen Aufschwung, der sich in steigenden Bewertungskennziffern oder auch steigenden Gewinnen niederschlägt, und das kann zu langem Hoffen führen. Und deswegen kann man aus der Sentimenttheorie meiner Ansicht nach nicht ableiten, wann die nächste Korrektur oder vielleicht der Crash kommt. Dafür eignet es sich noch nicht. Dafür müsste man vielleicht noch andere Indikatoren in Kombination mit hinzuziehen, um dann vielleicht irgendwann auch an der Stelle eine Aussage zu treffen. Ich kann das heute noch nicht.“
In wie weit sehen Sie noch Handlungsbedarf seitens der legislativen Institutionen, um den Finanzmarkt allgemein regulatorisch zu reformieren und effizienter, ggf. rationaler zu gestalten?
„Aufklärung statt Formulare! Die Eigenverantwortung der Anleger sollte gestärkt werden und nicht auf ein paar Kreuzchen auf einem Formular reduziert werden.“
Welche (geo)politischen Ereignisse haben den Kapitalmarkt mit Blick auf verhaltensökonomische Reaktionen besonders nachhaltig geprägt?
„Da gibt es unzählige Beispiele. In der jüngsten Vergangenheit würde ich anführen, dass die Handlungen von US-Präsident zu einem großen Teil positiv für die Aktienmärkte sind, entsprechend steigen die US-Börsen derzeit auch stark an. Doch in den Emotionen der Anleger herrscht das Gefühl vor, dass dies ja nicht sein kann oder darf, weil der Mensch Trump ja unlautere Mittel anwendet. Wir haben hier ein klassisches Beispiel für steigende Kurse an einer Wand von Zweifeln und Sorgen.
Aus dieser Perspektive betrachtet habe ich festgestellt, dass spätestens seit der Finanzkrise 2007 bis 2009 die Börsenweisheit ‚politische Börsen haben kurze Beine‘ ihre Bedeutung verloren hat. Seither reagieren die Finanzmärkte auf politische Entscheidungen, sind zunehmend von Emotionen getrieben und haben immer seltener Phasen, in denen sich die Bewertungsniveaus den fundamentalen Entwicklungen anpassen.“
Sehen Sie die Finanzkrise als Auslöser dieser Entwicklung oder hat Sie diese lediglich zu Tage gebracht?
„Also mir ist es da aufgefallen. Wissen Sie, ich schreibe jetzt schon seit 20 Jahren über die Börse und bis 2007/2008 konnte ich immer schreiben: ‚das ist nur ein politisches Thema, das wird sich durch die Fundamentalentwicklung sehr bald wieder ausgleichen‘. Und diese beruhigende Aussage hat sich dann 2009, insbesondere eben ab der starken Intervention der Politik in die Finanzmärkte, immer wieder als falsch herausgestellt und ist bis heute eigentlich noch nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt. Ich sehe das als eine Änderung, die nicht ewig hält, aber in diesem Markt befinden wir uns noch.“
In wie weit werden verhaltensorientierte Ansätze die traditionellen Finanzmarktkonzepte in Zukunft ablösen?
„Nicht ablösen, sondern ergänzen. Sentimentinformationen sind ein wichtiger Mosaikstein für die Anlageentscheidung und werden in den kommenden Jahren meiner Einschätzung nach immer stärker berücksichtigt, insbesondere wenn mathematische Zusammenhänge erarbeitet werden.“
Möchten Sie abschließend noch einen Gesichtspunkt anführen, der aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit Behavioral Finance sowie deren praktischen Umsetzung unbedingt Erwähnung finden und dem eine Diskussionsbasis geboten werden sollte?
„Mein Marktempfinden ist, dass viele, insbesondere institutionelle Anleger darauf warten, dass die Sentimenttheorie in Zahlen besser greifbar wird. Wie ich vorhin schon sagte, es gibt in Deutschland nur zwei solche Zahlenreihen. Ich arbeite ja daran, das Beta zur Verfügung zu stellen und auch Auswertungen an die Hand zu geben. Und egal mit wem ich über dieses Thema spreche, die sind alle hellauf begeistert und sagen ‚Halten Sie mich auf dem laufenden – ich werde dabei sein‘. Aber eben wie gesagt – immer als eine Komponente. Also ein Mosaiksteinchen, nicht als Ablösung der Finanzmarkttheorie.“

Stephan Heibel
Seit 1998 verfolge ich mit Begeisterung die US- und europäischen Aktienmärkte. Ich schreibe nun wöchentlich für mehr als 25.000 Mitglieder über die Hintergründe des Aktienmarktes und die Ursachen von Kursbewegungen. Heibel-Ticker Mitglieder schätzen meinen neutralen, simplen und unterhaltsamen Stil. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Anlageideen, um ihr Portfolio unabhängig zu optimieren.
heibel-ticker.de